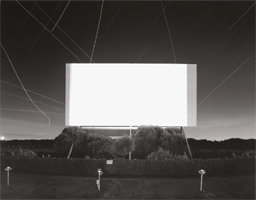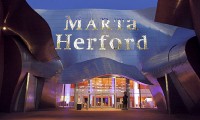Kunsthalle Bielefeld
Mit ihren ca. 500 Gemälden, 200 Skulpturen und ca. 4.500 Aquarellen, Zeichnungen und druckgrafischen Blättern ist die Bielefelder Sammlung bei weitem nicht so alt wie andere städtische Sammlungen, die oft auf dem Erbe fürstlicher Sammlungen beruhen. Das erste Bild, die Nummer eins im Sammlungsinventar, das Gemälde «Am Waldesrand» des Münchener Malers Ludwig Dill aus dem Jahr 1900, kam im Jahr 1905 nach Bielefeld. 1928 wurde das erste städtische Kunsthaus in der ehemaligen Villa des Kommerzienrates Tiemann an der Hindenburg- (heute Alfred-Bozi-) Straße eingerichtet und das Bild fand dort neben einigen weiteren seine Heimstatt unter der Obhut von Dr. Heinrich Becker, ehrenamtlicher Leiter des neuen Kunsthauses. Heinrich Becker ist mit seinem langjährigen Einsatz für die Kunst unbestritten die Gründerfigur des Bielefelder Kunstmuseumswesens. Beckers Vorliebe gehörte der deutschen Moderne. Sein Hauptaugenmerk galt den Entwicklungen seit dem späten 19. Jahrhundert, mit dem Schwerpunkt auf dem Expressionismus und dem lokalen Kunstschaffen sowie dem Werk von Käthe Kollwitz. Mit Gustav Vriesen kam 1954 der erste hauptamtlich berufene Kunsthistoriker als Leiter des Kunsthauses nach Bielefeld. Zu seinen ersten Ankäufen gehörten 1955 und 1956 zwei Werke, die einen fulminanten Auftakt markieren: Mit Max Beckmanns «Mutter mit spielendem Kind», das Beckmann 1946 in Amsterdam gemalt hat, holte Vriesen einen der wichtigsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts mit einem monumentalen Hauptwerk aus der unmittelbaren Nachkriegszeit in die Bielefelder Sammlung. Mit Willi Baumeisters frühem Materialbild «Drei gestaffelte Figuren, Ananke I» von 1920 gelangte ein erstes ungegenständliches Bild in die Kunsthaus-Sammlung. 1956 weitete Vriesen den Blick von der deutschen Kunst auf internationale Entwicklungen mit dem Schwerpunkt Frankreich und gab damit der Museumsarbeit in Bielefeld wie der Sammlung eine neue Richtung. Ihm folgte im Jahr 1962 Joachim Wolfgang von Moltke, der als Gründungsdirektor den Neubau der Kunsthalle und ihre Programmatik mitgestaltete. Die Wahl eines amerikanischen Architekten für das Gebäude bestimmte auch den Anspruch einer größeren Internationalität der Sammlung, der sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verwirklichen sollte. Vor allem unter dem Direktorat von Ulrich Weisner von 1974 bis 1994 kamen auch amerikanische Künstler wie Frank Stella, Kenneth Noland, Richard Serra, Ellsworth Kelly oder Agnes Martin in die Sammlung. Aber auch im Hinblick auf die deutsche Kunst verschob sich ab Mitte der 1970er Jahre der Schwerpunkt der Ankaufspolitik auf zeitgenössische Positionen, was ebenso den steigenden Preisen für Moderne Kunst auf dem Kunstmarkt Rechnung trug wie der Notwendigkeit, in einem Museum für Moderne Kunst auch den eigenen Zeithorizont abzubilden. Dieser Devise sind dann auch die nachfolgenden Direktoren Thomas Kellein und Friedrich Meschede gefolgt, indem Sie die Sammlung in die heutige Zeit geführt haben.
Unsere Sammlung sehen Sie in einer Auswahl auf der ersten Etage.